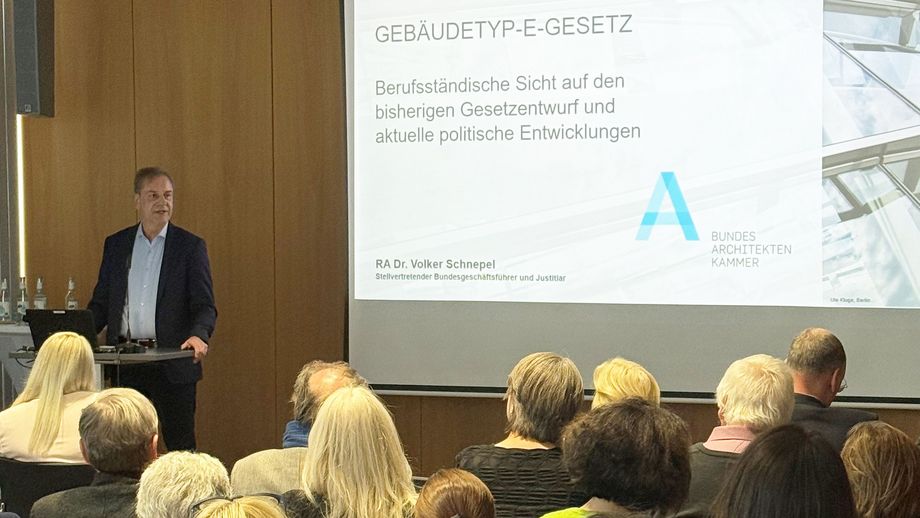Tagung "Architektur und Recht": Gebäudetyp-E rechtlich fundieren!
Das „E“ stehe für die Architektenschaft seit einiger Zeit als Kürzel für „einfach“ und „experimentell“, erklärte AKNW-Vorstandsmitglied Severine Nicolaus in ihrer Einführung zur Veranstaltung „Architektur und Recht“, zu der am 8. Mai rund 130 Kammermitglieder in die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gekommen waren. Thema der Veranstaltung war der „Gebäudetyp-E“, mit dem die deutschen Architektenkammern einen viel beachteten Vorschlag für eine normenreduziertes, einfacheres Planen und Bauen vorgelegt hatten. „Unser Ziel ist es, dass nur noch solche Normen als zwingend betrachtet werden sollen, die zur Gefahrenabwehr für Leib und Leben unverzichtbar sind“, führte die Vorsitzende des Ausschusses „Rechtsgrundlagen der Berufsausübung“ der AKNW aus.
Der Diskurs über den Gebäudetyp-E habe „lawinenartige Dimensionen“ angenommen, kommentierte Dr. Volker Schnepel, stellvertretender Bundesgeschäftsführer und Leiter der Rechtsabteilung der Bundesarchitektenkammer, in seinem Vortrag zur berufsständischen Einordnung des Status Quo. Erfreulich sei, dass einige Landesbauordnungen bereits reagiert hätten und angepasst worden seien, etwa in Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein. Auch der neue „Hamburg-Standard“ sei als Initiative für kostenreduziertes Bauen hier zuzurechnen. In Nordrhein-Westfalen biete der § 69 BauO NRW bereits Möglichkeiten zur Abweichung an.
Rechtliche Umsetzung fehlt noch
Noch sei der viel diskutierte „Gebäudetyp-E“ bundesrechtlich nicht umgesetzt. Die Kammern forderten weiterhin entsprechende Anpassungen im Zivilrecht, um spätere Haftungsprobleme für normenreduzierte Planungen auszuschließen. Architekten, die heute schon in Abstimmung mit ihren Auftraggebern einfacher bauen wollen, empfahl Volker Schnepel als Orientierung die „Leitlinie und Prozessempfehlung des BMWSB“ zum Gebäudetyp-E, die sich als Handreichung zur Aufklärung und Vertragsgestaltung allerdings noch auf die Möglichkeiten der aktuellen Rechtslage beziehe.
Schwierig sei gegenwärtig u.a. die Auslegung von § 633 BGB zu Sachmängeln. Die Leitlinie des Bundes betone einerseits, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRT) kein bindendes Recht darstellten; andererseits sei aber nach Auffassung des Bundesgerichtshofes die Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik grundsätzlich als Mindeststandard geschuldet, sofern nicht ein anderer Standard vereinbart worden ist. Eine solche Abweichung zu vereinbaren, sei zwar theoretisch möglich, aber immer mit einem extrem erhöhten Prozessrisiko verbunden und werde daher meist vermieden. Die Flut der a.a.R.d.T. erweise sich damit als Kostentreiber und Hindernis gerade beim Wohnungsbau. „Es gibt eine Diskrepanz zwischen Richterrecht und dem, was draußen im Lande passiert“, diagnostizierte Dr. Schnepel. Vor diesem Hintergrund habe schon der Baugerichtstag 2023 empfohlen, hier eine rechtlich saubere Regel herbeizuführen. Die Forderung der Architektenschaft laute, dass künftig – ohne ausdrückliche abweichende Vereinbarung - nur noch bautechnische Normen verpflichtend sein sollen, die sicherheitsrelevante Festlegungen enthalten. „Es gibt keinen guten Grund dafür, reine Komfort- und Ausstattungsstandards als grundsätzlich geschuldet zu betrachten.“
§ 69 BauO NRW ausreichend flexibel?
Dr. Gerd-Ulrich Kapteina und Nils Kramer, Baurechts-Juristen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, diskutierten in ihrem Vortrag die Frage, ob der § 69 BauO NRW 2018 „ausreichend flexibel“ sei. „Wir sprechen hier über Gefahrenabwehr“, unterstrich Kapteina. Nach § 3 BauO NRW seien in diesem Bereich die notwendigen anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Allerdings biete § 69 BauO Möglichkeiten zur Abweichung an. Abweichungen von den Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen NRW (VVTB) seien insbesondere zuzulassen, wenn es um die Modernisierung von Wohnungen oder Wohngebäuden geht, zur Einsparung von Wasser oder Energie, bei Nutzungsänderungen - sowie beim experimentellen Bauen.
Rechtsanwalt Nils Kramer stellte als einen Lösungsansatz dar, dass die Anwendung von § 69 durch das Einbinden von Sachverständigen abgesichert werden könne. Damit könne dann die Prüfung durch die Bauaufsicht entfallen. „Das würde ein Outsourcing von Aufgaben bedeuten.“
Ein weiterer Ansatz könne eine Umkehr der Beweislast im Bauantragsverfahren sein. Dann habe die Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen, dass die vorgeschlagene alternative Lösung die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Abweichungen nicht erfüllt, also mit konkreten Gefahren behaftet sei. Die Bauaufsichtsbehörde habe dann nachzuweisen, dass die andere Lösung die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Abweichungen nicht erfüllt.
Genehmigungssicherheit für Bauaufsicht
Die Leiterin der Bauaufsicht Düsseldorf, Ulrike Lappeßen, betonte, dass die Ablehnungsquote von Bauanträgen in der Landeshauptstadt bei unter zehn Prozent liege. „Wir möchten nicht ablehnen, sondern dass bei uns modernisiert und gebaut wird.“ Allerdings wolle die Bauaufsicht dazu beitragen, dass genehmigte Projekte auch gebaut werden könnten – ohne dass nach Genehmigung noch ein Baustopp ausgesprochen werden müsse. „Ich glaube, dass wir mit einem Gebäudetyp-E weiterkommen werden, weil es damit ermöglicht würde, praxisbezogene, pragmatisch orientierte Genehmigungen zu erteilen“, so Ulrike Lappeßen.
Konventionen überdenken
Das Nachdenken über das einfachere Bauen sei auf jeden Fall eine Chance, noch intensiver mit den Bauherr*innen darüber zu sprechen, was wirklich notwendig ist, erklärte AKNW-Vorstandsmitglied Friederike Proff. Stimmen aus dem Publikum wünschten sich mehr Flexibilität im Einzelfall nach niederländischem Vorbild; „das würde die Kreativität in Deutschland ungemein steigern“. Kritisiert wurde, dass viele Baustandards seien nicht im Verbraucherschutz begründet, sondern durch die Industrie initiiert worden seien.
Ulrike Lappeßen ergänzte, dass viele Eingaben an die Bauaufsichtsbehörde Düsseldorf gar nicht das Baurecht beträfen, sondern gesellschaftliche Konventionen. „Wir sollten den Diskurs nutzen, um auch ein gesellschaftliches Nachdenken über das Zusammenleben anzuregen.“
Teilen via