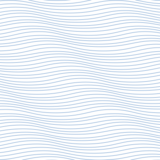"NRWlebt.": Barrieren auch in den Köpfen abbauen!
Die große Teilnehmerzahl im vollbesetzten großen Saal der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld brachte überzeugend zum Ausdruck, wie stark der Diskussionsbedarf zum Thema „Barrierefreiheit“ in der Architektenschaft und der Fachwelt ausgeprägt ist.
„Sie greifen ein wichtiges Thema auf, das in der Theorie allen bewusst ist, sich aber in der Praxis erst langsam durchsetzt“, bekräftigte beispielsweise Christian Decker. Der Architekt aus Lemgo stellte gemeinsam mit Jens Conrad als Bauherrenvertreter das generationenübergreifende Wohnprojekt „Pöstenhof“ vor. „Der Prozess war nicht einfach, vor allem weil es nicht viele Beispiele für solch ein ambitionierter Vorhaben in einer kleinen Stadt gab“, erinnerte sich Jens Conrad. Der Pöstenhof wurde weitgehend barrierefrei gestaltet, so dass Bewohner mit Rollstuhl und Rollator einziehen konnten. „Ein Freund fragte mich, was ich denn in dem Altenheim wolle“, erzählte der 43-jährige Vater zweier Kinder. „Barrieren sind oftmals im Kopf - und dort sind sie am schwersten abzubauen.“
Eine Aussage, die Norbert Killewald in seinem Vortrag nur bestätigen konnte. Der Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung in NRW darauf, dass gegenwärtig eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben und Verordnungen in Vorbereitung seien, die dazu beitragen sollten, den Anspruch auf Inklusion in NRW mit Leben zu füllen - vom Aktionsplan Betreuungsrecht über das Inklusionsstärkungsgesetz bis zur Landesbauordnung. In letzterer werde der § 55 geändert: Die Unterscheidung zwischen Nutzer und Besucher (Abs. 1) soll aufgehoben werden, die Ausnahmen in Absatz 6 entfallen und durch Härtefallregeln ersetzt werden. „Es muss aufhören, dass die Ausnahme zum Standard erklärt wird“, mahnte Killewald.
„Wir wollen eingebunden werden!“
Aber auch an die Landesregierung und die Kommunen formulierte der Landesbehindertenbeauftragte klare Forderungen: Die Sanierung im Bestand müsse voran gebracht werden. Und den Verfechtern der Behauptung, barrierefreier Wohnraum könne kein bezahlbarer Wohnraum sein, müsse entschieden entgegen getreten werden. „Solche Schutzbehauptungen blenden die Folgekosten für den kommunalen Haushalt und die Solidarkassen aus.“ An die Architekten und die Wohnungswirtschaft appellierte Norbert Killewald, der selber hörgeschädigt ist: „Wir Behinderte wollen eingebunden werden.“
Demografiefeste Unternehmenskultur
Die Alterung der Gesellschaft sei nicht allein für das Wohnen ein bauliches Problem, erklärte Hans Jörg Rothen in seinem Vortrag in Bielefeld. Der Forscher von der Bertelsmann Stiftung verwies darauf, dass die Gesellschaft insgesamt sich mit einem neuen Bild von älteren Menschen vertraut machen müsse. „Das ist nicht trivial, weil die Bilder in unserem Kopf auch vieles von dem bestimmen, was später in Gesetzen, Verordnungen und Strukturen konkrete Auswirkungen nach sich zieht.“ Viele Menschen blieben heute bis ins hohe Alter vital - aber nicht alle. Entsprechend müsse es verstärkt eine Ausdifferenzierung des Wohnungsangebotes geben. Aber auch unsere Arbeitswelten müssten dem steigenden Durchschnittsalter der Belegschaften angepasst werden. „Wir brauchen eine demografiebezogene Unternehmenskultur, die zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten und Unterstützungsangebot für die eigene Gesundheit und Fitness umfassen könne.
Eigene Haltung hinterfragen
Der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Ernst Uhing, unterstrich die Notwendigkeit, sich auf die Folgen des demografischen Wandels grundsätzlich einzustellen. „Vorträge, wie wir sie heute gehört haben, sind auch ein Anlass, die eigene Haltung zu Fragen von Alter und Handicap zu hinterfragen“, resümierte der AKNW-Präsident. Er verwies darauf, dass barrierearm gestaltete Wohn- und Lebenswelten allen Menschen zugute kämen - auch Radfahrern, Eltern mit Kinderwagen, Skatern. Insgesamt dürften alle Beteiligten nicht nachlassen in dem Bemühen, bezahlbaren Wohnraum für alle Gruppen der Gesellschaft bereit zu stellen. Selbst in schrumpfenden Städten mit erheblicher Leerstandsproblematik gebe es oftmals einen Mangel an barrierefreien Wohnungen.
Wir brauchen einen langen Atem!
Genau dies sei für viele Kommunen ein Problem, griff Pit Clausen, der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, das Thema auf. Oftmals unterscheide sich die Barrierefreiheit im Wohnungsangebot und auch im öffentlichen Raum von Quartier zu Quartier ganz erheblich. „Es bleibt nur eins: Wir müssen am Ball bleiben und dabei die Menschen einbeziehen“, meinte der Bielefelder OB. Im Neubaubereich sei vieles leicht umsetzbar, im Bestand allerdings gehe das oftmals nur langsam, Schritt für Schritt. „Da brauchen wir alle einen langen Atem.“
Die vorgestellten Projekte
„Besser ohne Barrieren“: Lebensgerechtes Wohnen in der Freien Scholle
Die Wohnungsbaugenossenschaft „Freie Scholle eG“ modernisiert in Bielefeld Wohnungsbestände aus den 1930er- und 60er-Jahren (Siedlung „Auf dem Langen Kampe“), wodurch die barrierefreie Nutzung der Wohnungen und des angrenzenden öffentlichen Raums möglich wurde. Im Rahmen des „Stadtumbaus „Albert-Schweitzer-Straße“ wurde Barrierefreiheit im bestandsersetzenden Neubau geschaffen (Foto, BKS Architekten: Krauß, Stanczus, Schurbohm + Partner). Mit einer Quote von nun 15 % barrierearmernoder barrierefreier Wohnungen liegt die „Freie Scholle“ deutlich über dem NRW-Durchschnitt von drei Prozent. Michael Seibt, Pressesprecher der Wohnungsbaugenossenschaft, und Timo Witt, Sprecher der Siedlung „Bültmannshof“, zeigten auf, wie die „erweiterte Selbstverwaltung“ der „Freien Scholle“ funktioniert.
Die Situation von körperlich und sensorisch beeinträchtigten Studierenden im Studienalltag - Was ist baulich zu tun?
Barrierefreiheit in der Universität: Hierbei geht es nicht nur um Rampen an Eingängen, Aufzüge, behindertengerechte Toiletten oder ausreichend breite Flure. Roswitha Rother und Philipp Möhle vom Referat für Studierende mit Behinderung und chronischen Erkrankungen der Universität Bielefeld machten in ihrem Vortrag deutlich, dass oftmals für körperlich oder sensorisch beeinträchtigte Studierende auch andere Barrieren dem Studium im Wege stehen – wie beispielsweise Brandschutztüren, die durch ihre Anordnung und ihr Gewicht von einem Rollstuhlfahrer nur schwer zu öffnen sind, oder große Hörsäle, in denen hörbehinderte Studierende ohne den Einbau einer Ringschleife, die ein komplikationsfreieres Hören ermöglicht, eigentlich kaum eine Chance haben, dem Stoff zu folgen.
Pöstenhof Lemgo – Ohne Schranken miteinander leben
Der Pöstenhof Lemgo – ein Wohnprojekt, in dem in 33 Wohnparteien Jung und Alt, Singles, Paare und Familien nicht nebeneinander her, sondern gemeinschaftlich zusammen leben. Der Architekt Christian Decker (h.s.d. Architekten) und Projektsprecher Jens Conrad schilderten die Entstehung des Gemeinschaftswohnprojektes mit all seinen Vor- und Nachteilen: Von der Anfangszeit im Jahr 2008, während der „Mitstreiter“ für das ehrgeizige Projekt gesucht wurden, über die Phase, in der auf dem Gelände der ehemaligen Konservenfabrik in Lemgo die Grundmauern errichtet wurden und sich Wünsche, Vorstellungen und Vorlieben der zukünftigen Bewohner mehrfach änderten, bis hin zum Richtfest und der offiziellen Eröffnung. Christian Decker und Jens Conrad verdeutlichten, dass ein gemeinschaftliches Wohnprojekt wie der Pöstenhof nicht stressfrei zu realisieren sind - dass sich der Aufwand und die Mühen am Ende jedoch in einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und mehr Lebensqualität auszahlen.
Die Manuskripte der Vorträge und Details zu den vorgestellten Bauprojekten finden Sie auf der Internet-Aktionsplattform www.nrw-lebt.de und in diesem Nachbericht.
Dort können Sie auch selbst weitere, eigene Objekte zu den sieben Unterthemen für das „Planen und Bauen im demografischen Wandel“ hochladen und damit zum Diskurs beitragen.
Die nächste „NRW.lebt“-Veranstaltung wird im Frühjahr 2015 in Köln stattfinden zum Thema „Mobil leben“.
Teilen via