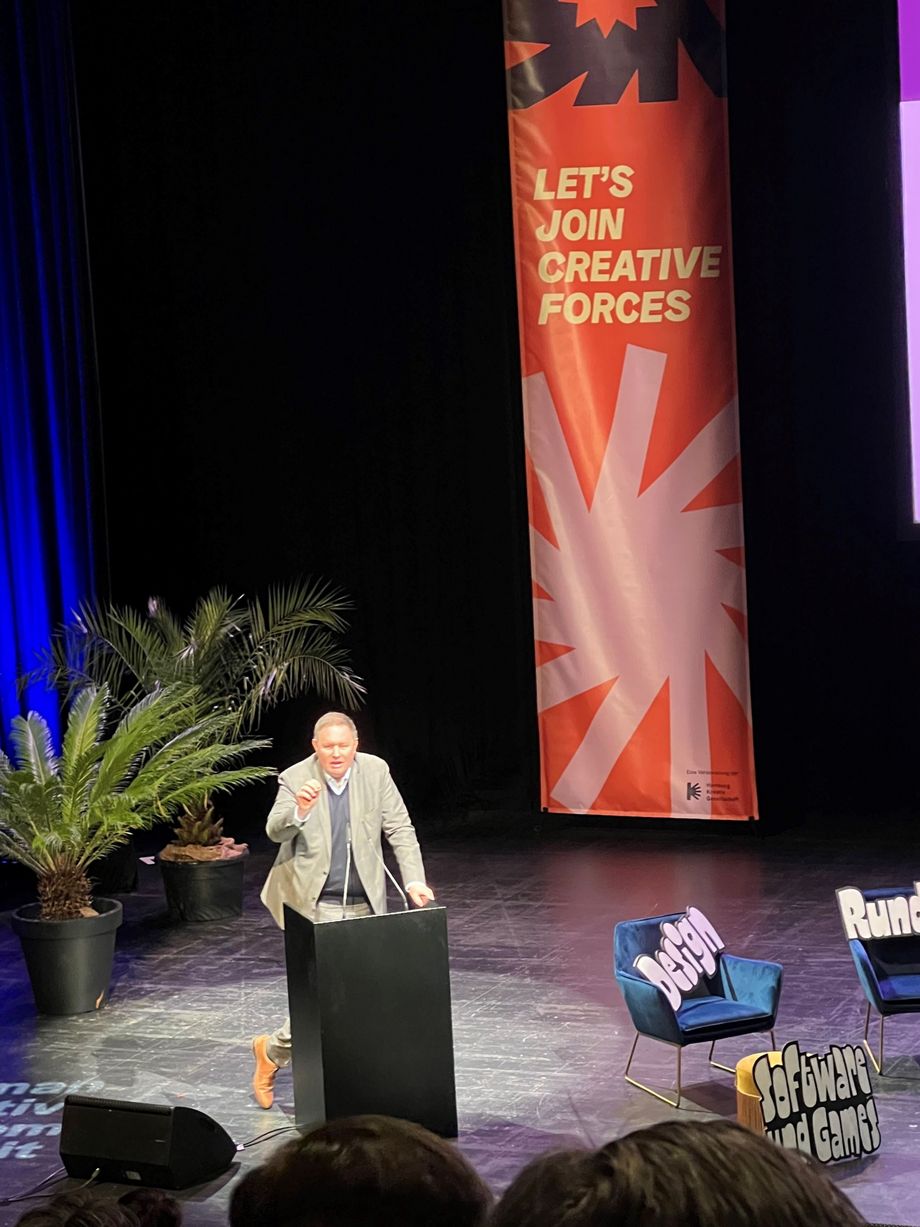German Creative Economy Summit: Kreative Community für die Demokratie
Die politische Umbruchphase in den USA und zahlreichen europäischen Ländern war als Leitmotiv durch die meisten der Panels hindurch wahrnehmbar: Am 5. und 6. März traf sich die deutsche Kreativbranche zu ihrem 2. bundesweiten Kongress in der Kulturlocation Kampnagel in Hamburg. Die Bundesarchitektenkammer war über die Koalition der Kultur- und Kreativwirtschaft k3d als Projektpartnerin an dem German Creative Economy Summit (GCES) beteiligt. Auch aus Nordrhein-Westfalen waren verschiedene Akteur*innen vor Ort, um das Netzwerk der kreativen Kräfte in Deutschland zu stärken – darunter die Agentur des Landes für die Kreativwirtschaft, creative.nrw, und die Architektenkammer NRW.
„Demokratien brauchen kreative Branchen, um sich weiterentwickeln zu können. Kreativwirtschaft braucht Freiheit und Demokratie, um wirksam sein zu können – und muss sich deshalb für diese Werte einsetzen!“ Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft, führte als Veranstalter des 2. GCES mit einem Blick auf das aktuelle Weltgeschehen mit diesem Appell in den Kongress ein. Notwendig seien dazu stabile Rahmenbedingungen sowie ein rascher Abbau von bürokratischen Hürden. Eine Umfrage, die anlässlich des Kongresses durchgeführt worden war, habe ergeben, dass sich die Branche steuerliche Entlastung und eine Erhöhung der Fördermöglichkeiten wünsche. „Die Kreativwirtschaft wird die Demokratie unterstützen, wo sie kann und wo es nötig ist“, sagte Egbert Rühl unter dem Applaus des Publikums.
Garant für Vielfalt
Dr. Carsten Brosda, Senator der Behörde für Kultur und Medien Hamburg, forderte die Branche auf, als relevante volkswirtschaftliche Größe „raus aus der Spielecke und rauf aufs Spielfeld“ zu gehen. In Zeiten der Transformation komme den kreativen Berufen eine wichtige, die Demokratie stabilisierende Funktion zu – als Garant von Vielfalt und Ideen, von den Künsten über das Design und die Architektur bis hin zu den Medien. „Wenn die Aufgaben so groß sind wie aktuell, müssen auch unsere Antworten groß gedacht werden“, ermutigte Hamburgs Kultursenator die über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreativkongresses. Dabei gelte es, zuversichtlich zu bleiben. „In einer Welt voller Dystopie ist am Ende die Utopie die notwendige Disruption“, so Carsten Brosda.
Eine wichtige Frage sei, inwieweit Schöpfung und Veröffentlichung künftig weiterhin getrennt bleiben könnten – oder durch KI übernommen werden. Wenn KI digitale Botschaften zunehmend personalisiert ausspielen kann, werde der Community-Gedanke einer demokratischen Gesellschaft zunehmend auf die Probe gestellt. Carsten Brosda rief dazu auf, für Europa eine eigenständige Technologiekompetenz zu entwickeln. „Wir können nicht die Technologie aus den USA oder China übernehmen und dann versuchen, diese mit Gesetzen einzuhegen.“
Macht es einen Unterschied, ob ein Mensch oder eine Maschine ein kreatives Werk realisiert hat? Senator Prosda: „Ich glaube, ja. Es braucht die menschliche Unberechenbarkeit im besten Sinne.“
Helmut Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsleitung im Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, warnte vor Eingriffen in die Pressefreiheit. Die ersten Amtshandlungen des amerikanischen Präsidenten seien Menetekel. „Wir hören Alarmsignale und darauf müssen wir reagieren. Schützt, was Ihr liebt“, rief Helmut Verdenhalven im Namen der Allianz „k3d“.
Großer Wirtschaftsfaktor
Die deutsche Kreativwirtschaft, die aus elf Säulen besteht, erzeugt einen Gesamtumsatz von über 200 Milliarden Euro im Jahr. „Die Branche steht damit auf Augenhöhe mit der Automobil – oder der Chemieindustrie“, erklärte Michael Kellner, Staatsekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Die Kreativwirtschaft stehe allerdings vor großen Herausforderungen. Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe, aber auch KI und Urheberschutz seien Fragestellungen, auf die man gemeinsam Antworten finden müsse. Dann könne die Kreativwirtschaft „als Zukunftsbranche ein volkwirtschaftlicher Motor für Deutschland und für Europa“ sein.
Darauf weisen auch die aktuellen Marktdaten der Branche hin, die Juliane Müller von der Forschungsgruppe „Goldmedia“ ergänzend vorstellte. Die Beschäftigtenzahlen lägen seit mehreren Jahren stabil bei etwa 1,2 Millionen Menschen. Allerdings biete die Entwicklung in verschiedenen Teilmärkten Anlass zur Sorge: Rückgänge verzeichnen die Bereiche TV- und Presse-Markt; Stagnation besteht im Werbemarkt. Auch die Architekturbranche weise rückläufige Tendenzen auf, so Juliane Müller unter Berufung auf Zahlen der Bundesarchitektenkammer. „Die direkte Kopplung an die Bauwirtschaft, die Entwicklung der Zinsen und die hohen Baupreise senden aktuell keine positiven Signale.“
Dialog mit Stadtgesellschaft
Karin Loosen, Präsidentin der Architektenkammer Hamburg und seit 20 Jahren freie Architektin, unterstrich die Bedeutung des Miteinanders der Kreativwirtschaft. „Wichtiger wird aber auch der Dialog nach außen, mit der Stadtgesellschaft“, stellte Loosen fest. Zentrale Aufgaben der Planungsbranche seien der klimagerechte Stadtumbau und das nachhaltige Planen und Bauen – und das Sprechen darüber. Dazu gehöre der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Partizipation an Stadtentwicklungsfragen und an Maßnahmen der Verkehrswende. „Wir stellen fest: Immer, wenn wir mit den Menschen reden und Planungen erläutern, stoßen wir mit unseren Themen auf Verständnis.“ Notwendig seien mehr Vielfalt, regelmäßige Wettbewerbe der guten Ideen, mehr Vermittlung und Beteiligung in der Entwicklung unserer gebauten Umwelt.
Gemeinschaft stärken
Die vielfältigen und durchaus inhaltlich stark unterschiedlichen Teilmärkte der deutschen Kreativwirtschaft enger zu vernetzen, ist das zentrale Ziel des „German Creative Economy Summit“. Die Diversität sei zugleich Stärke und Schwäche, war vielfach zu hören.
„Wirtschaftlicher Erfolg durch die Community“ lautete auch der Titel eines Panels, den die Koalition „k3d“ ausrichtete. Unter der Moderation von Christof Rose, stellvertretender Geschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, diskutierten der Hamburger Stadtplaner Volker Rathje, die Geschäftsführerin der Allianz Deutscher Designer, Victoria Ringleb, und der Erfinder des Wacken-Hardrock-Festivals, Holger Hübner darüber, wie die Gemeinschaft erfolgreiche Wirtschaftskonzepte in kreativen Märkten ermöglichen kann.
„Authentisch sein, Erlebnis ermöglichen, Gefühle ansprechen“ – das sei das Grundrezept des Wacken-Festivals, das 1990 mit 800 Teilnehmenden begann und heute regelmäßig 85.000 Musikfans anlockt. Mittlerweile gebe es Spin-Offs wie das „Full Metal Mayrhofen“, das Anfang April 2025 in dem österreichischen Skigebiet ein ganz anderes Setting bietet.
Für Victoria Ringleb braucht die kleinteilige Struktur von Segmenten wie dem Design starke Verbände, in denen die zahlreichen Einzelunternehmer*innen und Büros zu einer Gemeinschaft zusammengeführt werden. Stadtplaner Volker Rathje verwies auf die politische Wahrnehmbarkeit, die etwa die deutsche Architektenschaft über ihr Kammersystem erreiche. Er stellte zudem die Bedeutung öffentlicher Räume heraus, die „Community“ ermöglichen könnten. Einig zeigte sich das k3d-Panel, dass der Ausbau einer interdisziplinären Kooperation entlang der Wertschöpfungsketten kreative Impulse und wirtschaftliche Stärke generieren könnte.
Fokus Architektur
Der German Creative Economy Summit richtete in seinen Foren und Panels immer wieder den Blick auf Fragestellungen der Urbanistik und der Architektur. So sprach Prof. Mikala Holme Samsoe (ensomble Studio Architektur) zu einer zeitgemäßen Architektur. „Wir arbeiten mit gebrauchten Bauteilen und mit einer reduzierten Ästhetik.“ Reduktion sei – gegenüber dem Effizienz-Ansatz – der zukunftsfähige Weg. „Das rüttelt an Vielem, was wir über Generationen gelernt haben“, so Holme Samsoe. Klarheit, Homogenität und Eindeutigkeit im Material hätten aber eine große Kraft. „Für die progressive Architektur muss es darum gehen, vom linearen zum kreislaufbezogenen Planungsansatz zu kommen.“ Ein Ansatz, der für die Arbeiten der Kreativbranche insgesamt zielführend sei.
Teilen via